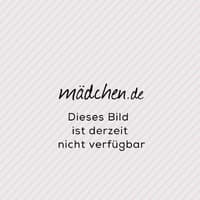Pflegefachfrau: Inhalte und Ablauf der Ausbildung
Neu an der Ausbildung ist, dass sie in den ersten beiden Jahren generalistisch ist. Das liegt nahe, da sich die Inhalte aller Tätigkeiten im Pflegebereich sehr ähneln. Hintergrund ist, dass diese neuen Fachkräfte in Zukunft flexibel eingesetzt werden bzw. arbeiten können. Sie sind nicht mehr so stark auf einen Arbeitsbereich festgelegt, was auch für die eigenen Karrieremöglichkeiten ein Hinzugewinn an Flexibilität ist (dazu am Ende noch mehr).
Trotz generalistischer Ausbildung besteht im dritten Lehrjahr die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Möglich ist eine Spezialisierung auf Altenpflege, Gesundheitspflege und Kinderkrankenpflege. Angesichts dessen lassen sich trotz neu geordneter Ausbildung in der Pflege weiter fachliche und persönliche Schwerpunkte setzen. Wer sich alle Optionen offenhalten will, schließt die Ausbildung als Pflegefachfrau als stark gefragter Allrounder (Generalist) ab.
Die Ausbildung ist dual organisiert. Sie findet in der Berufsschule und im Lehrbetrieb statt, sodass eine Kombination von Theorie und Praxis von Beginn an gegeben ist. Insgesamt überwiegen die berufspraktischen Anteile im Betrieb während der Ausbildung. Hier steht die praktische Ausbildung im Berufsalltag im Fokus. Schnell lernen angehende Pflegekräfte durch die fachliche Anleitung von Kollegen die wichtigsten Handgriffe und Hygieneregeln. Vor allem im Krankenhaus ist es üblich, dass Auszubildende unterschiedliche Stationen durchlaufen. Das kann als Chance für die weitere Karriereplanung genutzt werden, um in viele Bereich hineinzuschnuppern. Die theoretische Ausbildung startet mit den Grundlagen von Biologie, Anatomie und Chemie. Abgesehen von allen gesundheitsrelevanten Inhalten der Ausbildung stehen auch anfallende Verwaltungsaufgaben wie die notwendige Dokumentation auf dem Lehrplan.
Pflegefachfrau: So sieht der Arbeitsalltag aus
Der konkrete Arbeitsalltag hängt vom Einsatzgebiet je nach Spezialisierung ab. Unabhängig von der Zielgruppe leisten Pflegefachfrauen und -männer unterstützende Hilfeleistungen im Lebensalltag, die im Bereich der Gesundheitspflege auch rehabilitierender Natur sein können. Die Abläufe und Tagesroutinen hängen auch vom Einsatzort ab: In Altenheimen folgt die Arbeit anderen Strukturen als in einer Klinik oder einem Heim für betreutes Wohnen.
Die Pflege bzw. direkte Arbeit am Menschen steht im Fokus und bestimmt den Alltag. Gleichwohl machen auch Verwaltungsaufgaben wie die Dokumentation einen nicht unerheblichen Teil des Arbeitsalltags aus. Beispielhaft sei auf die folgenden Tätigkeiten verwiesen, die den Berufsalltag als Pflegefachfrau prägen:
- Durchführung und Dokumentation diverser Pflegemaßnahmen (Grundpflege, Körperpflege etc.).
- Lagerung und Aktivierung von Patienten (z. B. in den Rollstuhl setzen).
- Unterstützung beim Ankleiden und Essen.
- Kooperation mit Ärzten, Planung von Terminen.
- Messung von Vitalfunktionen, Überprüfung der Blutzuckerwerte.
- Medikamentengabe und Dokumentation.
- Bei Bedarf Verabreichung von Infusionen.
Wo arbeiten Pflegefachfrauen und -männer?
Im Falle eines generalistischen Ausbildungsabschlusses können diese begehrten Fachkräfte in unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitssektors arbeiten. Zu den wichtigsten zählen:
- Krankenhäuser und (Privat)kliniken.
- Seniorenheime/Pflegeheime.
- Gesundheitszentren, Arztpraxen.
- Ambulante Pflegedienste.
- Heime für betreutes Wohnen.
- Soziale Einrichtungen (Hospize etc.).
Durch die Option der Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr sind nach wie vor die folgenden 3 Tätigkeitsschwerpunkte in der Praxis festzustellen.
Tätigkeit in der Altenpflege
Sofern es sich nicht um einen ambulanten Pflegedienst handelt, werden Altenheime ein typischer Arbeitsort für die neuen Pflegefachkräfte sein. Hier werden die oben exemplarisch genannten Tätigkeiten den Arbeitsalltag prägen.
Einsatz in der Krankenpflege/Kinderkrankenpflege
Entscheiden sich die neuen Pflegefachkräfte für diesen Weg, werden sie auf Station in Kliniken/Krankenhäusern agieren und Patienten jeder Altersstufe behandeln (es sei denn, sie haben sich für den Schwerpunkt der Kinderkrankenpflege entschieden). Die Betreuung und Behandlung von Patienten stehen im Fokus. Zu nennen sind Tätigkeiten wie Verbandswechsel, Medikamentengabe und die Unterstützung von Ärzten bei Untersuchungen.
Heilerziehungspflege als Option
Möglich ist es auch, mit der neu geregelten Ausbildung den Schwerpunkt in der Heilerziehungspflege zu setzen. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung wird dann den Arbeitsalltag prägen: Von der Pflege bis hin zur Unterstützung und Förderung im Lebensalltag ist das Tätigkeitsspektrum sehr breit gefächert. Konkret hängt es vom Konzept der jeweiligen Einrichtung ab, sodass sich bereits mit dem Jobprofil bei der Stellensuche die eigenen Bedürfnisse gezielt berücksichtigen lassen.
Wie viel verdient ein/e Pflegefachfrau?
Diese begehrten und nach erfolgreicher Ausbildung staatlich anerkannten Pflegefachkräfte können mit einem Einstieggehalt von etwa 2.800 bis zu 3.000 Euro rechnen. Letztlich kommt es auf den Ort und die Frage an, ob die Vergütung nach Tarif erfolgt. In Privatkliniken bzw. bei privaten Trägern bestehen größere Möglichkeiten mit Blick auf Gehaltsverhandlungen.
Laut offiziellen Angaben liegt das Durchschnittsgehalt bei ca. 3.400 Euro. Je länger eine Pflegefachfrau/ein Pflegefachmann im Beruf arbeitet und je mehr sie/er sich spezialisiert, desto höher wird das Gehalt im Laufe der Jahre ausfallen. Mit einem optionalen Studium und der Übernahme von mehr Verantwortung kann das Gehalt perspektivisch über die Grenze von 5.000 Euro im Monat steigen.
Pflegefachfrau: Diese Karriereoptionen gibt es
Stellenangebote in der Pflege gibt es aktuell sehr viele. Mit einer guten Bewerbung hat man keine Probleme, eine passende Stelle als Pflegefrau in Kliniken oder Krankenhäusern zu finden. Wer langfristig planen und die Karriereleiter hinaufklettern möchte, sollte über eine Weiterbildung bzw. fachliche Spezialisierung nachdenken. Das kann sich im wahrsten Sinne mit einem höheren Gehalt bezahlt machen, denn durch Zusatzqualifikationen lässt sich der eigene Marktwert steigern.
Mit Fachweiterbildungen bzw. Spezialisierungen können sich Generalisten für besondere Bereiche in der Pflege empfehlen. Zu denken ist beispielsweise an ...
- Palliativpflege
- Intensivpflege
- Geriatrie, Rehabilitation
- Psychiatrie
- Spezialisierung auf Demenzerkrankte
- Wundmanagement
- Gesundheitsmanagement
Mit einer solchen Zusatzqualifikation kann eine Pflegefachfrau/ein Pflegefachmann eine leitende Position anvisieren bzw. sich insgesamt für die Übernahme von mehr Verantwortung empfehlen.
Möglich ist es auch, mit so genannten administrativen Weiterbildungen den beruflichen Schwerpunkt eher in den organisatorischen Bereich zu legen. Folgende Weiterbildungen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit:
- Fachwirt/in im Gesundheitswesen
- Pflegedienstleitung
- Betriebswirt/in für Management im Gesundheitswesen
- Stationsleiter/in
Nach der Ausbildung besteht auch die Option, ein Studium als Pflegefachfrau aufzunehmen. In den letzten Jahren ist das Angebot größer geworden, wodurch sich auch ein akademischer Abschluss nach erfolgreicher Berufsausbildung anstreben lässt. Mit einem Bachelorabschluss können sich Absolventen für Managementaufgaben im Pflege- bzw. Gesundheitsbetrieb empfehlen. Folgende Studiengänge kommen in Frage:
- Pflegemanagement
- Pflegewissenschaft
- Medizinische Assistenz
- Public Health
- Humanmedizin
Einige Angebote sind berufsbegleitend konzipiert, weshalb sich Arbeit und Weiterbildung für die eigenen Karrierepläne gut kombinieren lassen. Kosten für die Weiterbildung werden von einigen Arbeitnehmer anteilig übernommen, ferner sind Förderoptionen im jeweiligen Bundesland zu prüfen. Die Kosten für ein Studium sind übrigens steuerlich absetzbar, sofern ein unmittelbarer fachlicher Bezug zur Arbeitstätigkeit vorliegt.